Fallstudie zur Bedeutung erhöhter Salzkonzentrationen im Beregnungswasser unter den humiden Bedingungen Mitteleuropas
Neumann, K.-H. und B. Pauler
Institut für Pflanzenernährung der Justus-Liebig-Universität Gießen
12.) Na- und Cl-Konzentration im aufbereiteten Rheinwasser
Wie einleitend bereits dargestellt (s. Kap. 2, s.a. Übersicht 1), kommt von den verschiedenen dort aufgeführten Risikobereichen bei der Verwendung von Rheinwasser als Beregnungswasser dessen relativ hohem Gehalt an Natrium und Chlorid bei gleichzeitig niedrigem Ca- und Mg-Gehalt die größte Bedeutung für die Bodenfruchtbarkeit und die Ertragsbildung bei dessen Verregnung zu. Da unter mitteleuropäischen Bedingungen bisher nur wenig sichere Untersuchungsergebnisse zur Verwendung solcher Beregnungswässer vorliegen, erschien es erforderlich, eigene Untersuchungen zur Ermittlung von Grenzkonzentrationen dieser beiden Elemente unter den Bedingungen des Hessischen Rieds, die bei der Verwendung von aufbereitetem Rheinwasser zur Beregnung nicht überschritten werden sollen, durchzuführen. Diese Untersuchungen bestanden in der Hauptsache aus Feldversuchen, in denen unterschiedliche NaCl-Konzentrationen auf verschiedenen Böden, mit Grundwasserberegnung als Kontrolle, appliziert wurden, weiterhin aus Gefäßversuchen in Allmendfeld und Giessen mit ähnlicher Fragestellung wie bei den Feldversuchen, und schließlich aus einigen Labor-Modelluntersuchungen, bei denen u.a. auch Zellkulturen und Versuche mit kleinen Bodensäulen (HAGHIGHI, 1998; bisher unveröffentlichte Institutsergebnisse) mit eingesetzt wurden. Diesem Untersuchungsprogramm ist auch die in der Nähe des Rheins gelegene Parzelle X hinzuzurechnen, bei der seit Versuchsbeginn 1980 neben Grundwasser auch Rheinrohwasser zur Beregnung verwendet wurde.
Im Vergleich zum Salzgehalt im Beregnungswasser in tropischen und subtropischen Gebieten ist der Salzgehalt des Rheinwassers als niedrig anzusetzen. Für die Beurteilung der Qualität des Beregnungswassers unter den gegebenen Bedingungen des Untersuchungsgebietes und der im Rheinwasser vorgefundenen Salzkonzentrationen ist weniger die absolute Salzkonzentration als vielmehr der Anteil einzelner Ionen an der Salzfracht des Wassers von Bedeutung. Wie bereits angeführt, ist bei eher geringem Ca - und Mg-Gehalt der Na- und Cl-Gehalt des Rheinwassers relativ hoch und liegt beträchtlich über dem anderer Oberflächenwässer mit z.T. sehr viel höheren Ca- und Mg-Konzentrationen (s. Tabelle 49, S. III). Das Problem ist also weniger der hohe Na-Gehalt als die niedrigen Konzentrationen der beiden zweiwertigen Kationen Calcium und Magnesium. Das Risiko einer überhöhten Na-Konzentration im Beregnungswasser besteht in dessen Eintausch an den Bodenkolloiden gegen Calcium (und Magnesium) mit den bekannten negativen Folgen für die Bodenstruktur. Die mit dem Beregnungswasser dem Boden ebenfalls zugeführten Kationen Ca und Mg wirken diesem Na-Effekt entgegen, so daß sich die Bedeutung des Na-Angebotes im Beregnungswasser aus dem Konzentrationsverhältnis von Natrium zu Calcium und Magnesium ergibt. Diese Beziehung wird durch den SAR-Wert ausgedrückt (RICHARDS, 1954/1969)(Angaben der Ionen-Konzentration in mval.l-1):
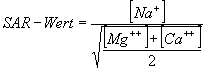
Je niedriger dieser Wert für ein Beregnungswasser ist, um so geringer wird sich ein überhöhtes Na-Angebot auf den Ionenbelag der Bodenkolloide auswirken und damit eine um so geringere negative Beeinflussung der Bodenstruktur nach sich ziehen. Bei der Beurteilung spielt weiterhin auch der absolute Salzgehalt des Beregnungswassers eine Rolle, indem bei höheren Salzkonzentrationen auch bei relativ niedrigem SAR-Wert mit negativen Folgen für das Pflanzenwachstum zu rechnen ist, wobei insbesondere osmotische Gesichtspunkte eine Rolle spielen.
Wie die Werte in Abbildung 24 und Abbildung 25 zeigen, folgt die nach dem EUF-Verfahren ermittelte Na- und Cl-Konzentration im Boden des Salinitätsversuchs III (alt) von 1984-1989 in der Tendenz den Konzentrationen dieser beiden Ionen in der mit Grundwasser beregneten Kontrolle, jedoch auf höherem Niveau.
Demnach ist auch in den einzelnen Jahren mit einer charakteristischen Belastung des Bodens durch diese beiden Ionen bei deren überhöhter Zufuhr durch die Beregnung zu rechnen. Auch hierbei hat der Witterungsverlauf, insbesondere die Niederschlagsverteilung und der Umfang der Niederschläge im Winter mit der daraus resultierenden Auswaschung, sicherlich eine zentrale Funktion.
Zieht man die amerikanische Klassifikation des Beregnungswassers nach dem SAR-Wert und der elektrischen Leitfähigkeit (RICHARDS, 1954/1969) heran (Abbildung 26), so ist nach dem Kriterium "elektrische Leitfähigkeit" das Rheinwasser mit 619± 252µS (Tabelle 40) als Beregnungswasser mit mittlerem Potential für Salzschäden und nach dem SAR-Wert (2.83± 1.43) als Beregnungswasser mit niedrigem Na-Effekt einzustufen. Nach dieser Beurteilung wäre somit eventuell mit mittleren Salzschäden für die Bodenfruchtbarkeit zu rechnen. Bei der Bewertung der Qualität von Beregnungswasser spielt aber auch die applizierte Menge sowie die durch nach der Beregnung folgende Niederschläge verursachte Salzauswaschung aus dem Boden eine Rolle.
In Tabelle 40 sind für die von uns verwendeten Beregnungswässer die Durchschnittswerte nach dem SAR-Index der Versuchsperiode von 1980-1992 und deren elektrischer Leitfähigkeit mit den ermittelten Schwankungsbreiten aufgeführt. Die für Rheinwasser ermittelten SAR-Werte liegen beträchtlich über dem der übrigen Wässer aus dem Hessischen Ried. Dagegen liegt der Mittelwert sowie die Standardabweichung der elektrischen Leitfähigkeit von Rheinrohwasser auf ähnlich hohem Niveau wie das als Kontrolle benutzte Grundwasser sowie von Grundwasser aus der Ringleitung. Demnach sollte die oben angeführte Einstufung von Rheinwasser als "mittel-gefährlich" nach dem Kriterium der elektrischen Leitfähigkeit entsprechend dem USDA-Verfahren (s. Abbildung 26) im Vergleich zur Verwendung von Grundwasser als Beregnungswasser hier ohne Bedeutung sein. Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte, auf deren Schwankungen im Verlauf eines Jahres bzw. einer Woche später eingegangen werden soll.